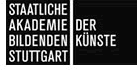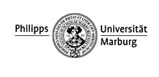<1>
Die Geschichte der eigenen Disziplin ist in unserem Fach Kunstgeschichte, wenn ich es von meinem Hamburger Aussichtsposten her richtig sehe, keineswegs stiefmütterlich behandelt worden. Sie hat vor allem die Form zahlreicher biographischer Studien und Porträts angenommen, die auch häufig methodengeschichtliche Perspektiven enthalten. Auch Publikationen zur Geschichte der Institutionalisierung der Kunstgeschichte sowie zur Geschichte einzelner Institutionen, Institute und ›Schulen‹ gibt es in größerer Zahl. Es wäre zunächst von großer Bedeutung, eine Bibliographie oder Datenbank dieser Literatur zusammenzustellen sowie den status quo der Forschung synthetisch darzustellen, etwa in einem Sammelband.
<2>
Was es, im Gegensatz zu anderen Fächern, etwa der Geschichtswissenschaft, für die Kunstgeschichte so gut wie noch nicht gibt, ist eine wissens- und wissenschaftssoziologische Annäherung an die Disziplin und an die Art ihrer Wissensproduktion in Strukturen universitärer und außeruniversitärer Institutionen. Die Exploration dieses Zugangs zur Geschichte unserer Disziplin wäre ein erster Schritt. Angeregt durch einen Aufsatz von Thomas Etzemüller (Universität Oldenburg) in Neue Zugänge zur Geschichte der Geschichtswissenschaft (2007), S. 27-68, stelle ich mir vor, dass dreierlei von Interesse sein könnte: Die Definition der Disziplin Kunstgeschichte als ein gesellschaftliches Teil-System im Sinne Luhmanns mit den damit einhergehenden Determinierungen der Denk- und Entwicklungsmöglichkeiten; die Untersuchung des Denkstils oder der Denkstile (Ludwig Fleck) sowie bestimmter Text- und Sprachkonventionen und ihrer Veränderungen, durch die das Fach sich von anderen Fächern unterscheidet; schließlich, den Ideen und Anregungen Pierre Bourdieus folgend, die Betrachtung des ›Feldes‹ Kunstgeschichte, in dem es wie überall um soziales Agieren innerhalb eines bestimmten Reglements, um Reputation und kulturelles Kapital geht. Welche sind diese Regeln, wie entsteht Autorität, wie formen sich neue Methoden, was setzt sich durch, was bleibt auf der Strecke und warum, was taucht plötzlich wieder aus der Versenkung auf und warum? In diesem Rahmen wären auch Untersuchungen systematisch am richtigen Ort, die die Rolle, welche den Kunsthistorikerinnen historisch zufiel und wie das ins Werk gesetzt wurde, genauer belegten.
<3>
Zu den Materialien, aus denen diese Soziologie der Kunstgeschichte – die sicher viel mit verwandten Fächern gemeinsam hat, sich aber ebenso sicher in mancher Hinsicht von ihnen unterscheidet – schöpft, gehören (historische) Berufungsakten, Nachrufe, Nachlässe (z.B. im Deutschen Kunstarchiv im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg), Vorlesungsverzeichnisse, Zeitschriften des Faches, populärwissenschaftliche Publikationen, Kongresse und andere mehr. Für die Auswertung solcher ›Quellen‹ gibt es bereits Ansätze in der Exilforschung sowie in den Untersuchungen zur Kunstgeschichte im Nationalsozialismus. Von großer Bedeutung wäre es aber zu versuchen, diese Analysen zu verknüpfen mit den methodischen und inhaltlichen Verschiebungen in der Beschäftigung mit dem kunstgeschichtlichen Gegenstandsfeld, wie das etwa David Thimme für das Werk Percy Ernst Schramms geleistet hat.
<4>
Es wäre außerdem wünschenswert, im Rahmen des Möglichen komparatistisch vorzugehen und andere nationale Organisationen des Faches in die Untersuchungen einzubeziehen. Grundlagen dafür werden zur Zeit für das Handbuch Art History and Visual Studies in Europe (Hg. Rampley, Lenain, Locher, Pinotti, Schoell-Glass, Zijlmans) erarbeitet.
<5>
Diese Erweiterung unseres Blickfeldes auf uns selbst und unsere Disziplin wäre nur als ein größeres Forschungsprojekt zu realisieren, die richtige Form dafür sollte diskutiert werden.
Lizenz
Jedermann darf dieses Werk unter den Bedingungen der Digital Peer Publishing Lizenz elektronisch übermitteln und zum Download bereitstellen. Der Lizenztext ist im Internet abrufbar unter der Adresse http://www.dipp.nrw.de/lizenzen/dppl/dppl/DPPL_v2_de_06-2004.html
Empfohlene Zitierweise
Schoell-Glass C.: Bemerkungen zu Forschungsdesideraten hinsichtlich der Wissenschaftssoziologie der Kunstgeschichte. In: Kunstgeschichte. Texte zur Diskussion, 2009-16 (urn:nbn:de:0009-23-17681).
Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Artikels die exakte URL und das Datum Ihres letzten Besuchs bei dieser Online-Adresse an.
Kommentare
Es liegen noch keine Kommentare vor.
Möchten Sie Stellung zu diesem Artikel nehmen oder haben Sie Ergänzungen?