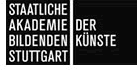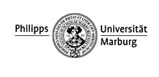<1>
Auf das ›Beispiel Berlin‹ gedachte ich 1973 meine Dissertation Kunstgeschichte als Institution. Studien zur Geschichte einer Disziplin zu beschränken. Dafür dass ich in dem Text, der dann 1979 erschien, davon abgerückt bin, gibt es zwei Gründe: 1. Die wichtigsten Archivalien, die diese Fokussierung ermöglicht hätten, lagen damals – kriegs- und nachkriegsbedingt – in der Abteilung II des Staatsarchivs der DDR in Merseburg. Wenn überhaupt, durfte man das Archiv in der Regel nur einmal besuchen. 2. Fast alle Kommilitonen und Hochschullehrer, denen ich über ›mein Thema‹ erzählte, fragten mich, ob ich mit diesem interessanten, aber doch sehr randständigen Thema überhaupt Kunsthistoriker werden könne. Ob ich das eigene Nest beschmutzen wolle, wünschten andere zu wissen. Durch solche Fragen erfuhr ich: Wer nicht nur Geschichten erzählen, sondern tatsächlich Geschichte schreiben will, muss in diesem Fall grundlegend arbeiten; ich durfte nicht allein eine Fallstudie über das Berliner Seminar vorlegen.
<2>
Kommilitoninnen und Kommilitonen, mit denen ich mich über die Vorurteile wundern und dann über Forschungsprobleme austauschen konnte, traf ich allein in Bielefeld (Irene Below), in Heidelberg (Gabriele Bickendorf), in Marburg (Wolfgang Beyrodt, Horst Bredekamp und Hans Werner Schmidt) und in Berlin (Anna Bak-Gara). Hochschullehrer der Kunstgeschichte, die sich dafür interessierten, konnte ich in Braunschweig (Martin Gosebruch), in Kassel (Wolfgang Kemp), in Marburg (Heinrich Klotz und Martin Warnke) und München (Willibald Sauerländer und Thomas Lersch) besuchen. Das meiste aber, was ich für meine Dissertation lernte, stammte aus einer interdisziplinären Arbeitsgruppe »Fallstudien zur Wissenschaftsgeschichte«, die Wolf Lepenies an der Freien Universität Berlin 1973 eingerichtet und bis 1980 geleitet hat. Von Thomas S. Kuhns Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen ausgehend wurden darin wissenschaftssoziologische und -theoretische Texte von Robert King Merton bis Karl Popper und von Gaston Bachelard bis Michel Foucault referiert und diskutiert. Zugleich wurde an Dissertationen über die Geschichte der Volkswirtschaft (Wolf-Hagen Krauth), der Jurisprudenz (Gerhard Podstawski), der Friedensforschung (Christel Krauth-Görg), der Göttinger Schule der Geschichtswissenschaft (James Ryding), der Psychologie um 1800 (Werner Obermeit), der Wissenschaftstheorie (Rodrigo Jokisch) und eben auch der Kunstgeschichte gearbeitet. Der Kreis der Interessierten war also sehr klein.
<3>
Heute, 35 Jahre später, lockt – wie jüngst erfahren – das Thema ›200 Jahre Kunstgeschichte in Berlin‹ weit mehr als 100 Zuhörer an drei Tagen zu 27 Vorträgen und Diskussionen in den Senatssaal der Humboldt-Universität zu Berlin. Acht Tage später wird diese große Tagung von einer kleineren noch getoppt: Über einen einzigen der vielen, bedeutenden Berliner Kunsthistoriker, Franz Theodor Kugler, handeln 16 Referenten in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Nach den Diskussionen mit etwa 30 weiteren Experten und Interessierten stellen sie fest, dass längst nicht alle wesentlichen Aspekte angesprochen und auch die nunmehr frei zugänglichen Archive längst noch nicht ausgeschöpft worden sind: Kugler als Dichter z.B. sei nur gerade mal angetippt worden; über sein mehrwöchiges Engagement für die Akademie der Künste in Berlin während der 1848er Revolution hätte man viel ausführlicher handeln müssen; wissenschaftsgeschichtlich wäre es ebenso wichtig gewesen, auf seine Freunde und Gegner näher einzugehen; denn allein Jacob Burckhardt und Carl Schnaase als Beispiele herauszustellen, sei zu wenig gewesen. Schließlich sprächen andere Wissenschaftsforscher über eine Berliner Schule der Kunstgeschichte! Sie verwendeten somit einen Begriff, der ebenso wie der der Wiener Schule der Kunstgeschichte kritisch zu hinterfragen sei.
<4>
Braucht es noch weiterer Belege, um auch für das Fach Kunstgeschichte folgende Einsicht der Wissenschaftsforschung zu realisieren? Gewiss! Denn man sähe es ja gern exakt belegt, dass auch hier das wissenschaftliche Wissen exponentiell wächst! Das heißt: Alle 15 Jahre verdoppelt sich das wissenschaftlich gesicherte Wissen! Selbst wenn man diese These von Derek John de Solla Price für die ›weichen Wissenschaften‹, also für die Geistes-, Sozial- und Geschichtswissenschaften nicht uneingeschränkt akzeptiert, und wenn man dagegen halten möchte, dass auch die Probleme exponentiell wachsen, ist folgendes nicht von der Hand zu weisen: Geschichte der Kunstgeschichte ist ein Forschungsgebiet, das vom äußersten Rand des weiten kunsthistorischen Feldes mehr und mehr in dessen Mitte driftet. Daher liegt es nur nahe, für diese inzwischen stark anwachsende Gruppe von Forscherinnen und Forschern ein Forum zu schaffen, – ein Forum, auf dem man sich über neu entdeckte Quellen, über frische Erkenntnisse schnell austauschen und weit über die wertvollen Informationen von arthistoricum.net hinaus mit Bedacht über Vorhaben insbesondere dann absprechen kann, wenn diese sich nur arbeitsteilig verwirklichen lassen.
<5>
Fällig ist ein solches Forum ohnehin. Bildet es doch eine nahezu unabdingbare Stufe auf dem Weg zur vollen Institutionalisierung wissenschaftlicher Arbeitsgebiete. Dieser führt bekanntlich im allgemeinen vom ›einsamen Forscher‹ über Korrespondenzen, Tagungen, Zeitschriften, Kongresse zu Lehrstühlen und Instituten – ein ganz normaler, allzu normaler Verlauf, bei dem der nächste Schritt bereits bedacht werden sollte: Die Vertreter der drei größten kunsthistorischen Dokumentationszentren in Deutschland – die Kunstbibliothek Berlin, Foto Marburg und das Zentralinstitut in München – , in denen ein großes Interesse an der Disziplingeschichte herrscht, sollten sich in dieser Hinsicht absprechen.
<6>
Dabei muss man meines Erachtens ein Paradoxon stets im Auge behalten. Es gibt nämlich ein Charakteristikum der Wissenschaftsgeschichte, das, würde es in anderen Fällen praktiziert, von Wissenschaftlern kaum geduldet würde. Schon Pierre Bourdieu hat darauf aufmerksam gemacht. Vergleichbar mit einer Kunstgeschichte, die ausschließlich von Künstlern geschrieben wäre, ist Wissenschaftsgeschichte fast durchweg Gelehrten-, Disziplin- und Institutionsgeschichte, die von den Angehörigen der jeweiligen Fächer, Universitäten und Forschungsinstitutionen selbst verfasst wird. Weil man als Wissenschaftswissenschaftler in dieser Falle sitzt, besteht die große Gefahr, dass man sich das enge Gefängnis recht schön redet und schreibt. Aus dieser Zwangslage gilt es Konsequenzen zu ziehen! Die erste Konsequenz ist m. E. nach die: Mit den Mitgefangenen, d. h. zu den Nachbardisziplinen ist möglichst enger Kontakt zu pflegen, um das System, dessen Teil man untersucht, genau kennen zu lernen – z. B. zum Arbeitskreis ›Geschichte der Germanistik‹, der bereits seit 1972 existiert, eine eigene Zeitschrift publiziert und am Deutschen Literaturarchiv in Marbach angesiedelt ist. Die zweite Konsequenz ist die: Der Allgemeinen Wissenschaftsgeschichte, die es zwar gibt, die aber nur schwach ausgebildet ist – gerade mal ein Max-Planck-Institut in Deutschland! –, ist ein prominenter Platz auf dem Forum einzuräumen. Das heißt: Weil bereits einige Kunsthistoriker am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin gearbeitet haben, ist der Kontakt weiter zu pflegen und die Zusammenarbeit auszubauen. Die dritte Konsequenz heißt: Es gilt dem Rechnung zu tragen, dass es auch hier Bindestrichdisziplinen gibt. Sie heißen Wissenschaftstheorie und Wissenschaftssoziologie! Und die Konsequenz aus den drei Konsequenzen ist die: Das wissenschaftsgeschichtliche Forum der Kunstgeschichte muss in erster Linie einer fachübergreifenden Wissenschaftsforschung dienen. Nur so kann es auch ein Korrektiv der Kunstgeschichte bleiben.
Lizenz
Jedermann darf dieses Werk unter den Bedingungen der Digital Peer Publishing Lizenz elektronisch übermitteln und zum Download bereitstellen. Der Lizenztext ist im Internet abrufbar unter der Adresse http://www.dipp.nrw.de/lizenzen/dppl/dppl/DPPL_v2_de_06-2004.html
Empfohlene Zitierweise
Dilly H.: Schön, solch ein Forum »Geschichte der Kunstgeschichte«! Wem aber dient es?. In: Kunstgeschichte. Texte zur Diskussion, 2009-5 (urn:nbn:de:0009-23-17662).
Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Artikels die exakte URL und das Datum Ihres letzten Besuchs bei dieser Online-Adresse an.
Kommentare
Es liegen noch keine Kommentare vor.
Möchten Sie Stellung zu diesem Artikel nehmen oder haben Sie Ergänzungen?